„You shouldn’t think of her as being a woman. That would be your first mistake.“ –
„Salt“, „Wanted“. etc…: In den letzten Jahren wurde der Filmfan immer wieder mit manch hyperkinetischem, weiblichen Gegenentwurf bzw. Post-9/11-Genre-Spielereien zum radikalem Realismus der ins Leben gerufenen, variierenden Bond-Interpretationen Marke „Jason Bourne“ von Paul Greengrass konfrontiert. Dabei wurde man Rezipient zahlreicher, actionlastiger Elemente, die für moderne Blockbuster unabdingbar scheinen. Und zwar solange, bis genannte Genrebeiträge sich in ihrem reinem visuellem Selbstzweck bzw. ihrer Ideenarmut recht zügig erschöpften. Wobei letztendlich die Frage offen bleibt: was sollte nach einem gescheitertem Experiment wie „Salt“ mit Angelina Jolie beispielsweise (als herumspringende Bourne-Groteske mit Brüsten) im zu Grunde liegenden Genre „jetzt“ noch folgen? Die Antwort: Steven Soderberghs „Haywire“.
„You want me to be eye candy?“ –
In „Haywire“ darf nun also Kampfkunstamazone Gina Carano mit solider, antrainierter Physis und dank konsequenter, entgegen positionierter „Tritt in den Hintern“-Attitüde nun ihren Häschern zeigen, was Aufrichtigkeit, „Rache“ und ein dazugehöriger Tritt/Schlag ins Gesicht so alles bewirken können. Regisseur Steven Soderbergh verordnet seiner „Rape & Revenge“-Story um seiner verratenen Protagonistin absichtlich eine lange nicht mehr gesehene Schmalspurdiät. Er befreit sie „gewollt“ von aller sonst erstrebenswert immanenten Komplexität, was ihm durchaus zum Nachteil gereichen könnte, und am Ende auch von größeren, zu erreichenden Zielen abhält. Auf der anderen Seite gerät „Haywire“ gerade durch die augenscheinlich narrative Simplizität bzw. den eiskalt eingeschlagenen, geradlinigen Rachepfad in Punkto Inszenierung ehrlicher und integerer, als es beispielsweise „Salt“ und „Wanted“ je sein könnten. In „Haywire“ entgegnet einem wieder Steven Soderberghs typische, bekannte Regisseurhandschrift aus „Oceans Eleven“ oder anderen bekannten Mainstream-Blockbustern. Der Zuschauer wird Zeuge eines künstlerischen Ergusses aus dem entsprechendem, auf den Betrachter einprasselnden Sixties-Retro-Charme (vielleicht noch bekannt aus „Schirm, Charme & Melone“ oder auch die älteren „Connery“ Bond Filmen), dem typischen „Bronson“-Revenge-Flair der Siebziger, etwa wenn Gina Carano „den“ eiskalten, bekannten Blick der Filmgeschichte als Killerin erkennen lässt (denn die abgebrühte Wirkung eines Charles Bronson ist ihr tatsächlich wesens-immanent), ihre breiten Schultern wie einst Lucy Lawless in „Xena“ zur Schau stellen und soviel Sexiness wie Angelina Jolie selbst an den Tag legen darf. Ja, sie zeigt eigenwilliges und erstmal gewöhnungsbedürftiges Charisma, aber trotzdem „echtes Schauspiel“.
„You’re the eye.“ –
Darüber hinaus gerät „Haywire“ Dank der harten, authentischen und lobenswerten Auseinandersetzungen zu einem vitalem, körperlichem Erlebnis, das sich vor Bond bzw. Post-Bourne-9/11-Inszenierungen nicht verstecken muss. Und dank unterlegtem Score aus Bass, Beat und Gitarre atmet er die bekannte „Oceans Eleven“ Lässigkeit. Steven Soderbergh gibt einerseits den talentierten Popkultur-Rezipienten der Moderne, wenn er alle Versatzstücke zu etwas am Ende doch eigenständigem vor seinem aufgezogenem narrativem Hintergrund zusammenfügt, zitiert sich dadurch fleißig selbst, beispielsweise wenn verschiedene Handlungsstücke am Anfang von „Haywire“ in bekannter, kompliziert wirkender „Traffic“-Manier zusammengefügt werden, ja selbst Michael Douglas gibt ein weiteres Gastspiel nach „Traffic – die Macht des Kartells.“ Spätestens nach dem Verrat der Protagonistin und den ersten Verfolgungsjagden gerät „Haywire“ damit weniger zu einem Film der Extraklasse, mehr jedoch zu einer netten, routinierten und kurzweiligen Genre-Spielerei, die ab und an sogar Spaß macht, etwa wenn Antonio Banderas alle Latino Klischees auf die Spitze treibt. Dass sich „Haywire“ am Ende aber nicht mehr als eine routinierte bis solide inszenierte Spielerei erweist, liegt nicht nur an der absichtlichen, schmalspurigen Erzählung. Gaststars wie der immer gern gesehen Bill Paxton („Aliens – die Rückkehr“, „Titanic“, „True Lies“) werden zu einem entsprechendem Plotdevice degradiert, auch Channing Tatum darf sich nur darauf reduzieren lassen. Den wunderbaren Schauspielern Mathieu Kassovitz und Antonio Banderas wird ebenfalls keine Entwicklung in ihren Rollen durch das Drehbuch zugestanden. Schade…
„You better run.“ –
Fazit: „Haywire“ gerät also nicht zu filmischen Totalausfall, ebenso wenig zu einem Genre-Highlight. Der Film verströmt den Gestus einer Spielerei. Es ist etwas schade, dass sich Steven Soderbergh seit „Contagion“ nur noch auf sein leichtes Routinehandwerk verlässt und auch laut den Medien dem Filmgeschäft in Zukunft den Rücken kehren will. Aber wenigstens zeigt er mit einem Fingerschnippen Regisseuren wie beispielsweise Phillip Noyce („Salt“), wo die eigenen Fertigkeiten mit mageren „girls with guns“-Inzenierungsgrenzen liegen.
[Wertung]
blockbusterandmore: 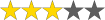 (3 / 5)
(3 / 5)
