„I am not pretty. I am not beautiful. I am as radiant as the sun.“ –
Die Umsetzungen von erfolgreichen Romanen für die große Leinwand ist immer so eine Sache. Nur allzu leicht läuft man Gefahr, der Tragweite von entsprechenden Vorlagen nicht gerecht werden zu können. Hunderte Seiten komprimiert auf wenige Spielfilmminuten: wenn man versucht, die Vorlage um einige Passagen zu entschlacken, um dabei eine wichtige Essenz für den eigenen Film zu filtern, ist das Geschrei groß. Dabei sollte man nicht vergessen, der kinematographischen Essenz wichtige kritische, komplexe Untertöne und einen eigenen, entsprechenden dramatischen Überbau hinzuzufügen. Denn dieser trägt das Medium Film, das nunmal grundsätzlich anders funktioniert als eine literarische Ansammlung von Ideen bzw. Gedanken.
„Welcome, and Happy Hunger Games.“ –
Ebenso vermeidet man den narrativen Leerlauf der zu Grunde liegenden Vorlage. Ein werkgetreues Abfilmen dieser hat bis jetzt ebenso ohne eigene zündende Ideen (siehe auch „Watchmen“ als Graphic Novel Adaption) und den Willen zur Entgegnung des vorhersehbaren Ausgangs einer Geschichte nur selten funktioniert. Und leider ist auch die bisher gehypte Adaption der „Tribute von Panem“ von den gängigen, bereits etablierten Problemen des modernen Blockbusterkinos betroffen.
Zu Beginn von „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ findet Regisseur Gary Ross das richtige Gespür für seine Bilder, instruiert seine Darsteller, wie die überzeugende Jennifer Lawrence, richtig, setzt spürbar auf ehrliche, bittere Emotionen und setzt zumindest eine Weile auf einen erwachsenen, erzählerischen Tonfall, welcher hin und wieder vom allzu überkandideltem und dekandent wirkend gewolltem Auftritt von Elizabeth Banks als Casting Organisatorin Mrs. Everdeen (für die sogenannten „Hungerspiele“) unterbrochen wird. Schon Dank diesem schauspielerischem Aspekt kann man bereits erahnen, wohin „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ den Betrachter nach einer recht soliden Zugfahrt und dem Auftauchen des gut agierenden Woody Harrelson als „Mentor“ Haymitch Abernathy noch führen werden: Zu einem Erlebnis, das einem persönlich in den wenigen guten aber auch schlechten Momenten regelrecht zum Transpirieren bringt.
„Stupid people are dangerous.“ –
Bereist mit dem ersten Blick auf die Hauptstadt von „Panem“ macht sich der erste Schock breit. An dieser Stelle darf man sich gerne fragen, was die Macher dazu bewogen hat, die Stadt „Panem“ derart optisch missraten bzw fernab von allseits bekannten, hier und da noch existierenden, globalen, postmodernen Völker-Diktaturen ins Leben zu rufen (welche einen realistischen Bezug zu mannigfaltigen gesellschaftlichen, politischen und menschlichen Themen bieten), als es darum ging, eine in sich zerfallene, dekadente Gesellschaft optisch bewußt zu skizzieren bzw. auf Grund der Romanvorlage entsprechend zu adaptieren. Wobei diese Beteiligten zu funktionalen Abziehbildern und „beinahe“ Karikaturen durch die Optik degradiert werden. Da hätte jemand mal den Beteiligten mitteilen sollen, dass sich die Dekadenz einer Gesellschaft nicht durch die entsprechende, übertriebene Kostümierung, die an Opernbälle und Karnevals Feiern erinnert, sondern durch das vorgetragene, zerrissene Seelenleben definiert.
„Primrose Everdeen!“ „Prim! I volunteer as Tribute!“ „Well, that is lovely from you, young lady. But we had not had any Tributes from District 12 in years! Oh but what the hey! That’s the spirit of the games!“ –
An gesellschaftlich-kritischen Zwischentönen ist Regisseur Gary Ross zu keiner Zeit gelegen, die visuellen Schauwerte verkommen zu einem reinem Selbstzweck. In Punkto innerer Ausstattung der Titel-gebenden Stadt, der Kostümierung der BewohnerInnen und etablierter, gesellschaftlicher Rituale wird man maximal Zeuge davon, wie er sich als emsig bemühter Regisseur wohl „Gladiator“ von Regisseur Sir Ridley Scott angeschaut hat, wie ein verspieltes Kind mit den Fingern in den pastellfarbenen Topf gegriffen und ein entsprechendes Setting entworfen hat, dass im Kontrast zur rauen Realität nicht nur befremdlich wirkt, sondern auch ärgerlicheweise unzählige Erzählmuster ohne neue Variationen bedient. Höhepunkt dieser gesellschaftlichen Maskerade: die nachgestellten, karikaturenhaften und im Gegensatz zu richtigen Epen einem Klischee entsprungenen römischen Tribünen, auf denen sich die Mächtigen über der Gesellschaft erheben.
Als schlimm offenbart sich auch jener Teil der Inszenierung, wenn der zum Beispiel penetrant-aufgesetzt grinsende Stanley Tucci als schon vom Trailer bekannter „Talkmaster“ und beinahe „Drag Queen“ die schauspielerische Bühne betritt. Dann offenbart sich die Inszenierung in „Die Tribute von Panem“ „beinahe“ als satirereif. Beinahe, denn alleine das Bedienen eines wandelnden Jay Leno Talkmaster-Klischees namens Caesar Flickerman auf zwei Beinen rechtfertigt noch keine richtige Satire.
Dank der relativ schwachen Dialoge wird das Ziel verfehlt. So bewegt sich Stanley Tucci in seiner Rolle im inszenatorischen Vakuum und beginnt ab und an regerecht zu nerven. Ebenso gilt das für das anwesende Publikum, dss in Punkto Boshaftigkeit kaum durchdrungen wird, ebenso selten wie genannter Talkmaster. Die „Die Tribute von Panem“ erfahren über die komplette Laufzeit Dank in dieser Rezension bis jetzt genannten optischen und inhaltlichen Schwächen einen ziemlich befremdlichen, unpassend (optisch) cartoonhaften und sonderbaren Beigeschmack, der von Wes Bentley als pseudoteuflisch wirkender Seneca Crane bzw. einer beinahe Harald Glööckler Karikatur und später noch auftauchenden, futuristischen Vehikeln verstärkt wird. „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ bilden anders als viele vergleichbare Science Fiction und Fantasy Epen wie „Lord Of The Rings“ und „Star Wars“ leider keine homogene Einheit. Neben einigen emotionalen, durchaus packenden Momenten im Film. Und nachdem die entsprechenden, obligatorischen Trainingsparts als Vorbereitung auf die tödlichen Spiele, kleine kalkulierte Geschichten zwecks Sponsorensuche und das übliche 1à—1 des persönlichen Haderns um Schicksal und Zukunft absolviert wurden, nehmen „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ auch schon Fahrt auf. Wobei man sich dann fragen darf: was ist denn das, was man in diesem Film dann zu sehen bekommt? Regisseur Gary Ross schlachtet die erste Romanvorlage von Suzanne Collins unter Zuhilfenahme von Scriptwriter Billy Ray regelrecht aus und verkauft sie als gewolltes Überwältigungsspektakel ohne tiefere komplexe Zusammenhänge.
Das Rezept für die auf den Betrachter einstürzende, anstrengende „Gladiator“-Kindergartensause sieht dann wie folgt aus: Zum einen nehme man die wichtigsten und spannendsten Szenen und entstelle sie durch hektisches Kamera-Gewackel, wenn es richtig zur Sache, sprich um Leben und Tod geht… Nur erkennt man nicht einmal annähernd soviel, wie man gerne sehen würde.
Dazu serviere man eine Kinderrassel/Pubertätsbande, deren Motive in Bezug auf die persönlichen Handlungen bis auf das übliche überleben wollen und nicht mal im Ansatz hinterfragt werden, ganz zu schweigen davon, warum nicht geklärt wird, warum sie alle überragende, kämpferische Fähigkeiten besitzen. Auf etwaige zu Grunde liegende Ausbildungen der Gegner geht Gary Ross nur oberflächlich ein, ebenso wie auf „Katniss“ Beweggründe zur Ausbildung als Jägerin. Solche Logiklöcher findet man in „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ zuhauf. Diese in dieser Rezension zu kommentieren würde glatt den Rahmen sprengen. Dazu serviere man: austauschbare und farblose Gegner, die sich einem klinisch-kaltem Möchtegern Perfektionismus unterordnen müssen und so schnell das Zeitliche segnen, bis man nicht mal bis 3 gezählt hat.
Der Zuschauer erhält so überhaupt keine Chance, eine entsprechende, emotionale Bindung zu den Darstellern aufbauen zu können, um im Film mitgerissen bzw. berührt zu werden; sie ordnen sich nur dem schematischen Gut gegen Böse Konzept unter, eine charakterliche Entwicklung der Gegner wird in „Die Tribute von Panem“ geradezu konsequent und sträflich missachtet. Dazu gesellt sich noch das obligatorische konstruierte Lovestorytum alias „Lord of the rings“, welches auch in „Avatar“ zweckentfremdet wurde und für den überschaubaren Rahmen bzw. den kühl berechneten Plan des Regisseurs den Sinn und Zweck hat, „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ als von narrativer Komplexität, von moralischen Grautönen, Ecken und Kanten befreites Spektakel sauber bzw. abgeleckt wirkend über die Zeit zu bringen. Nebenbei wird natürlich noch das obligatorische offene Ende, nebst unnötigem Twist, etabliert.
Zu keiner Zeit kommen einem Dank der Inszenierung ernsthafte Zweifel daran auf, das es „Katniss“ als Protagonistin wahrlich schwer haben wird, zu überleben. Regisseur Gary Ross verhebt sich nicht nur in seinen inszenatorischen Zwischentönen, sondern inszeniert einen Blockbuster, der vom Inhalt und der Machart her austauschbarer nicht sein könnte. Wenn Jennifer Lawrence am Ende von „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ die erste Runde der todbringenden Spiele übersteht, hätte auch Daniel Radcliffe als „Harry Potter“ mit dem Zug an entsprechender Stelle nach Hause fahren können. Wenn Donald Sutherland in seiner Rolle die letzten Schritte geht, könnte man ihn auch mit Professor Dumbledore verwechseln, welcher Harry Potter dabei beobachtet, wie er auf „Seidenschnabel“ davonfliegt.
„Die Tribute von Panem“ erweisen sich im Endeffekt leider nur als knallharte kalkulierte Finanzmasche ohne Herz bzw. richtige Seele. Eine Romanverfilmung, die man locker in einen Topf mit Gurken wie „Clash Of The Titans“ werfen kann. Regisseur Gary Ross entwirft in „Die Tribute von Panem“ ein zynisches, menschenverachtendes und reaktionäres Welt- und Gesellschaftsbild, das leider des öfteren unzureichend hinterfragt wird, damit sich etwaige Zweifel an der entsprechenden Ideologie und der Gesellschaft in alle Winde zerstreuen: Warum existieren die Hungerspiele überhaupt? Warum hält man die Distrikte „überhaupt“ von einem Aufstand ab? Man hätte relevante gesellschaftskritische Themen nicht einfach ausklammern, sondern zu Gunsten der ersten Verfilmung aus den weiteren Romanen konsequent verschieben, etwas komplett eigenständiges erschaffen, nicht nur brav den ersten Roman als belanglose Erbauungsgeschichte verfilmen sollen.
Fazit: Ohne Skrupel reiht Regisseur Gary Ross ein breit getretenes, zur Genüge bekanntes Erzähl-Element an das andere, zu keiner Zeit ist ersichtlich, dass er seiner Verfilmung „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ seine „eigene“ Handschrift als Stempel aufdrückt. Und auch ein paar gelungene Action Momente wie das „Wespennest“ beispielsweise können dieses gravierende Manko nicht verschleiern. Dazu fällt die Screentime der neben Jennifer Lawrence interessantesten Darsteller wie Lenny Kravitz(!) und Donald Sutherland ebenfalls zu kurz aus. Diese Nebenfiguren können keine wichtigen Akzente sitzen. „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ erweist sich einfach nur als höchst uninteressantestes „Blockbuster Entertainment Of Modern Art.“
[Wertung]
blockbusterandmore: 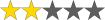 (2 / 5)
(2 / 5)
